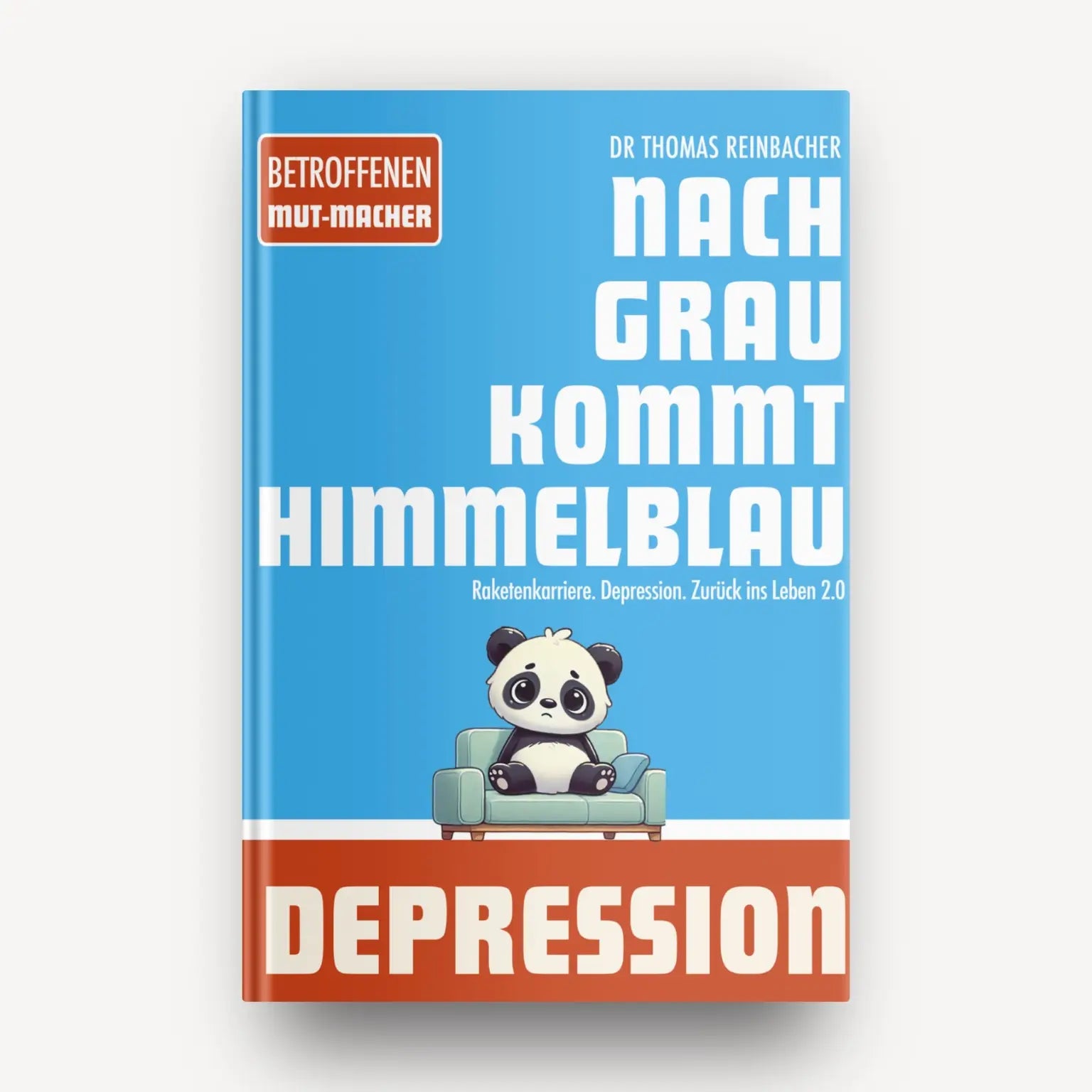Leseprobe »Die Sicht der Anderen« aus Nach Grau kommt Himmelblau
Diese Leseprobe gibt es auch zum Anhören.
Die Sicht der Anderen - Meine Frau
Ich bin Xiaoxi, Thomas’ Frau. In jener Zeit, in der die Depression in unser Leben kam, war es schwer für mich, Thomas zu verstehen. Ich war nicht in der Lage, seine Gemüts- und Gefühlslage zu erkennen. Diese ganze Depression war mir ein großes Rätsel. Wir waren uns bis dahin immer so nah, aber ich spürte zu dieser Zeit, dass wir noch nie so weit voneinander entfernt waren.
Ich habe mich lange Zeit von der naiven Hoffnung leiten lassen, dass alles wieder gut wird, sobald er die richtigen Medikamente hat und seine Psychotherapie beginnt. Bis dahin ist er halt »komisch«. Diese Hoffnung hat mir auch geholfen. Eine gewisse Naivität ist bei einer Depression nämlich genauso wichtig wie bei einem Start-up. Würde man a priori schon wissen, wie mühsam und schwierig es werden wird, man würde gar nicht anfangen zu kämpfen!
Als es dann so weit war und Thomas nach seiner ersten Episode aus dem Krankenhaus entlassen wurde, dachte ich, dass er jetzt wieder gesund ist. Sonst hätten sie ihn doch nicht entlassen! Sein Arzt und seine Psychotherapeutin waren sich einig: er kann und soll wieder arbeiten. Thomas und ich haben uns auf die Expertise der Fachleute verlassen. Das ist doch ihr tägliches Geschäft.
Thomas selbst war immer noch etwas neben der Spur. Je näher der erste Arbeitstag kam, desto öfter hat er mir morgens gesagt: »Es geht mir nicht gut!« Wie oft habe ich das in dieser Zeit gehört! Mich hat sein »Es geht mir nicht gut« schon ziemlich genervt. Die Krankenhausentlassung und die Ärzte gaben das OK, wieder zu arbeiten. Was hat er denn noch?
Ich habe ihn und sein Befinden ignoriert und fühlte mich nicht mehr so eng mit ihm verbunden wie früher – war mir sogar nicht mehr so sicher, ob ich ihn noch so liebe wie früher. Ich habe mit der Zeit einen Selbstschutz aufgebaut und dadurch auch eine gewisse Distanz, ich brauchte Abstand.
Abstand, damit ich nicht selbst runtergezogen wurde und ausbrannte. Es war eine beinharte Zeit für mich. Ich musste mein geliebtes Start-up aufgeben, um mich Vollzeit um unser Kind und um Thomas zu kümmern. Er war nicht in der Lage, Dinge auf die Reihe zu bringen. Wohnungen vermieten, Kind gesund pflegen, Kindergeburtstag schmeißen, Kindergartenplatz organisieren, Steuererklärungen machen etc., alles ist auf einmal an mir hängen geblieben. Das waren früher alles Thomas’ Aufgaben, die er nebenbei erledigt hat. Thomas hat mich immer verwöhnt, hat sich um wirklich alles gekümmert. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich seine »Prinzessin«. Das, so weiß ich heute, war auch Teil des Problems: immer anderen zu helfen, sich selbst zu vergessen.
Ich hatte keine Hilfe, denn unsere beiden Familien wohnen nicht in München. Ich war sehr ausgelaugt. Heute weiß ich, dass ich in dieser Zeit eine Art Mini-Burnout hatte. Für zwei Wochen habe ich nichts anderes gemacht, außer unseren kleinen Schatz in die Kita zu fahren und ihn wieder abzuholen. Die restliche Zeit habe ich mich zu Hause auf dem Sofa versteckt und Prime Video gebinged. Einfache Kost. Ich hatte keine Energie, um mir selbst etwas zu kochen. Ich habe irgendwelches Junk-Food in mich reingestopft. Ich fühlte mich wie ein Opfer seiner blöden Krankheit und fragte mich: »Warum wir? Warum ich? Womit haben wir das verdient?«
Erst als ich begann, mit jemandem über meine Gefühle und meine Situation zu sprechen, wurde es besser. Ich habe mich an eine enge Freundin von mir gewandt, die als psychologische Coachin arbeitet. Sie gab mir einen wertvollen Rat: »Kümmere dich zuerst um dich selbst, dann erst um Thomas.« Bei ihr konnte ich über alles sprechen. Sie gab mir viele Tipps. In jener Zeit war ich nicht in der Lage, alle Tipps umzusetzen, aber ich hatte sie von da an zumindest im Hinterkopf. Sie hat mich motiviert, neue Dinge auszuprobieren. Damals haben mir dann letztendlich Sport, Yoga, Tanzen und mein kleiner Nik geholfen, vom Sofa aufzustehen und diese Lähmung abzuschütteln. Es war eine Art »Selbstrettung«.
Yoga war eine exzellente Entscheidung. Ich ging jeden Tag ins Yoga. Beim Yoga habe ich für ein, zwei Stunden alle Sorgen und die Beklommenheit vergessen. Es hat mich nicht nur fit gemacht, sondern mir auch eine innere Stärke gegeben.
Als es für Thomas nach der ersten Episode in Richtung Wiedereinstieg bei Google ging, wünschte ich mir nichts mehr, als unser altes Leben zurück. Wir haben die letzten zehn Jahre so viel gegeben, so hart gearbeitet. Ich dachte, seine Ängste vor dem Arbeitsbeginn waren normal, denn jedes Mal, wenn Thomas etwas Neues anfing, hatte er Angst. Diesmal verständlicherweise halt ein wenig mehr. Aber »The Show Must Go On!«
Er war in dieser Zeit reizbar und schwierig im Umgang. Das waren Charakterzüge, die ich von meinem lieben Mann in den zwölf Jahren Partnerschaft nicht kannte. Manchmal dachte ich, es sei kindisch, dass er sich jetzt über dieses und jenes, was ich gesagt habe, aufgeregt hat. Ich habe viele Dinge gesagt, die mir heute noch sehr leid tun. Dinge, wie »Get your shit together«. Oder als er mich um Rat fragte, ob er bei Google nicht in einem niedrigeren Level wieder einsteigen sollte, wegen weniger Stress und so, habe ich es ihm ausgeredet. Der – also der alte Thomas – ist doch sofort mega unzufrieden, wenn es wieder Jahre dauert, bis er befördert wird!
Ich dachte eben an den alten Thomas, das echte »Arbeitstier«, das er vor der Depression war. Aber er war sich schon bewusst, dass er es nicht mehr schaffen würde. Ich habe es nur nicht erkannt. In der Retrospektive ist mir klar, dass sein seltsames Verhalten doch nur die Symptome einer Depression waren, die noch nicht vollständig abgeklungen war. Die Depression war leider nicht vorbei. Wir alle, inklusive Thomas, wollten das Thema einfach nur beenden. Schluss, aus, Deckel drauf!
Wir haben nicht realisiert, dass wir unser Leben drastisch hätten ändern müssen. Den Lebensstil fortzusetzen, der die Erkrankung gefördert hat, war fatal.
Sein zweiter Absturz hat auch mich völlig aus der Bahn geworfen. Alles ist so wahnsinnig schnell gegangen. Als wir schon wussten, dass es möglicherweise wieder losgeht, versuchte ich panisch, ihn nochmals herauszuholen. Purer Aktionismus. Ich habe ihn gezwungen, jeden Tag mit mir ins Fitnessstudio zu gehen. Jeden Tag Yoga und Pilates zu machen. In der Hoffnung, dass wir es durch Ablenkung schaffen können. Die Yoga- und Pilates-Übungen waren für ihn eine Qual. Anfangs konnten die Stunden im Fitnessstudio noch ein wenig ablenken, aber mit jedem Tag wurde es für ihn schwerer, aus dem negativen Gedankenkreis auszusteigen. Im Yoga sah ich, wie er schon nach fünf Minuten völlig ausgelaugt war. Da war das Aufwärmen noch gar nicht vorbei.
Er ist die darauffolgenden Tage regelrecht verfallen. Ich bat ihn einmal, Spinat mit Pasta für Nik zu kochen. Er kocht normalerweise gut, aber er hat es nicht mehr hinbekommen. Er war sichtlich überfordert. Ich sah ihn mit Schweißperlen auf der Stirn in der Küche stehen und wie er unkontrolliert mit dem Kochlöffel herumfuchtelte. Es kam mir vor, als ob er sehr unter Stress stand, aber nur in Zeitlupe funktionierte. Der Spinat war verbrannt, die Pasta weit weg von al dente.
Als er mir dann gebeichtet hat, dass er die letzten zwei Nächte kein Auge zugetan hat und im Wohnzimmer auf und ab gelaufen ist, war mir klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Er hat nicht geschlafen und uns, Nik und mich, nicht geweckt, um sich Hilfe zu holen. Typisch Thomas! Das ganze »Vielleicht bekommen wir es noch einmal hin«-Denken half nichts mehr. Das Szenario, vor dem wir uns alle so gefürchtet haben, ist eingetreten. Episode zwei.
Was dann kam, hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Szene mit dem »Er lügt!«-Zettel kennt ihr ja. Mir hat es in dem Moment das Herz zerrissen. Aber was sollte ich anderes machen, ich hätte es mir nie verzeihen können, wenn er sich wirklich etwas angetan hätte. Er wollte nicht eingesperrt werden, aber ich sah schon lange, dass seine Gedanken nicht mehr klar waren und ich seinen Aussagen nicht mehr zu 100 % vertrauen konnte.
Während wir auf die Aufnahme auf die geschlossene Station gewartet haben, sprach er immer davon, dass ich und Nik einen Plan B brauchen. Plan B war, in seinen durch die Depression verzerrten Gedanken, ein Leben ohne Thomas. Ich habe ihn scharf zurechtgewiesen: »Es gibt keinen Plan B! Das kannst du vergessen! Es gibt nur einen Plan, Plan A. Du musst wieder gesund werden. Wie lange es dauert, ist mir egal, ich werde an deiner Seite sein! Aber deinen Plan B, den gibt es nicht! Du musst unserem Nik noch so viel beibringen.« Thomas hat mir nicht geglaubt, aber mir war es wichtig, dass ich das in aller Klarheit gesagt habe.
In der ersten Episode hatte ich ja Schwierigkeiten, seine Gefühlswelt zu verstehen. Dieses Mal brauchte ich seine Gefühle nicht zu verstehen. Allein, wenn ich seinen Körper anschaute, habe ich verstanden, dass es ihm richtig dreckig ging. Der rechte Mundwinkel hing lustlos nach unten, der linke war straff nach oben gezogen. In seiner linken Armbeuge hat es alle paar Sekunden gezuckt. Am schlimmsten war aber das permanente Zittern in seinen Füßen.
Während der Zeit in der geschlossenen Abteilung war Thomas in seiner eigenen Welt. Er verstand nicht mehr, was um ihn herum geschah. Er erzählte mir viele Dinge, die völlig falsch waren. Kompletter Schwachsinn. Eines Tages erzählte er mir, der Arzt habe ihm gesagt, dass dieses neurologische Problem in den Beinen nie mehr verschwinden wird. Das hat mich wirklich getroffen. Ich war so unglaublich traurig. »Auch wenn er ein Pflegefall wird, werde ich an seiner Seite bleiben!«, dachte ich mir. Ich wollte sofort mit dem Arzt sprechen. Aber der Arzt sah mich verwundert an. Schwachsinn, das hatte er Thomas nie gesagt. Es war nur seine Interpretation in seinem kranken Kopf. Was der Arzt wirklich sagte, war, dass sie glaubten, dass es eine Nebenwirkung der Medikamente war und sie aktuell davon ausgehen, dass es später von allein aufhört. Bei einer anderen Gelegenheit erzählte mir Thomas, dass der Arzt ihm gerade zehn weitere Tabletten angeordnet hätte. Ich sprach wieder mit dem Arzt und er sah mich wieder verwundert an. Er gab Thomas nur eine neue Tablette zusätzlich. Von diesem Moment an wusste ich, dass diese Krankheit Thomas völlig zerstört hatte. Körperlich und seelisch. Der Thomas, den ich so viele Jahre gekannt und geliebt hatte, war weg. Was blieb, war jemand, der wie Thomas aussah, er aber nicht war.
Das war ein Schock, der mich sehr erschüttert hat. Ich konnte kaum glauben, was ich da sah. Erst jetzt habe ich endlich verstanden, wie heimtückisch eine Depression ist. Aber ohne die extremen äußerlichen Symptome hätte ich es vielleicht wieder nicht verstanden. Obwohl ich in dieser Zeit durchgehend weinen wollte, habe ich mich gezwungen, nicht vor ihm zu weinen. Ich musste ihm Hoffnung geben. Für Thomas muss das alles unerträglich gewesen sein. Es war wie mit dem sprichwörtlichen Eisberg, der die Titanic zum Sinken brachte. Als Angehöriger siehst du immer nur die Spitze, aber als Patient siehst du den ganzen fetten Eisberg. Ich habe gelernt, dass ich als Angehöriger alles mit zehn multiplizieren muss, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es Thomas seelisch in seinen Episoden wirklich ging.
Ich fühlte mich so unfassbar schuldig. Ich konnte sehen, wie ausgezehrt Thomas nach seiner ersten Episode war, dass er keine Kontrolle mehr über seinen Körper hatte. Und trotzdem habe ich ihm gut zugeredet, wollte ihn überzeugen, dass es gut war, sein altes, normales Leben wieder aufzunehmen. »Klar gehst du wieder zu Google! Warum willst du Teilzeit arbeiten? Warum in einem niedrigeren Level anfangen? Ich kann dein »Es geht mir nicht gut« nicht mehr hören. Alle sagen, du bist gesund, lass uns einfach weitermachen. Für uns, für Nik.«
Ich fühlte mich so schuldig, aber dieses Mal mache ich alles besser! Meine Liebe zu Thomas, habe ich noch nie so intensiv gespürt wie in diesen Tagen. Ich kann ihn nicht verlieren! Tränen habe ich in dieser Zeit nicht zugelassen. Ich glaube, da gibt es diesen Punkt, seelisch, wo aus Selbstschutz Tränen gar nicht erst aufsteigen. Ich durfte nicht zerbrechen. Nicht jetzt! In dem Moment passierte ein Wechsel: vom Opfer zum Starksein. Für mich gab es nur noch den einen Weg: stark zu sein. Nicht einzuknicken. Nicht nachzugeben.
Ich wusste nicht, wie es ausgehen würde.
Mir haben die Ärzte damals schon gesagt, dass sie alles probieren würden. Aber eben auch, dass es eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das motorische Zucken nicht mehr weggehen würde. Ob Thomas ein Pflegefall werden würde, keine Ahnung, es war zumindest ein Szenario, das auf dem Tisch war. Vor Thomas habe ich meine Sorgen natürlich verborgen, damit er nicht dachte, dass ich an seiner Genesung zweifelte.Ich habe mir geschworen, dass ich an seiner Seite sein werde und nicht einen Millimeter weggehe, auch wenn er ein Pflegefall werden sollte. Auch wenn wir alles verkaufen müssten, was wir uns so hart erarbeitet haben, ist es mir egal. Thomas und ich haben vor Jahren eine Miniatur-Holzbank gekauft, auf der zwei Figuren aus Porzellan sitzen. Sie sind bunt angemalt und sollen ein glückliches Rentnerpärchen darstellen. Beide mit großen Bäuchen, Brillen und grauen Haaren. Sehr zufrieden und dankbar sehen sie aus, da auf ihrer Bank. Halten Händchen. Das war für uns schon seit Jahren eine tägliche Erinnerung, dass wir unser Leben bis zum Schluss miteinander verbringen wollen. Das Erste, was ich getan habe, war, ihm dieses kleine Kunstwerk ins Krankenhaus zu bringen. »Wenn du gar nicht mehr kannst, Thomas«, habe ich gesagt, »dann sieh dir bitte die beiden an. So sieht Plan A aus, egal, wie scheiße es gerade ist.«
Und dann gab es ja noch Nik, unseren Sonnenschein. Jeden Tag nach dem Krankenhaus fuhr ich direkt zur Kinderkrippe, um Nik abzuholen. Ich rief laut »Niki« und er lief mir überglücklich mit zwei weit ausgestreckten Händen entgegen. Herzliche Umarmung, Küsse. Diese kleine Endorphin-Maschine! Rührende Momente. Momente, um in dieser so dunklen Zeit Energie zu tanken. Ich konnte meine Sorgen und Ängste um Thomas nur in der Zeit vergessen, als ich mich um Nik gekümmert habe. Wenn ich mit ihm zusammen war, war ich wie in einer Blase, in der alles gut war. Der kleine Sonnenschein hat mir die Kraft gegeben, durchzuhalten.

In der Akutphase war ich jeden Tag mehrere Stunden im Krankenhaus bei Thomas. Wir haben uns immer im Patientengarten getroffen. Er durfte ja in dieser Phase die Klinik nicht allein verlassen, die Örtlichkeit war uns aber ohnehin egal. Hauptsache, ich habe ihn gesehen. Beim Gehen habe ich ihn gestützt. Das Knacksen seiner Gelenke habe ich noch heute im Ohr. Jeden Tag habe ich für ihn gekocht und das Essen in die Klinik gebracht. Immer etwas, von dem ich wusste, dass es ihm schmecken würde. Zu sehen, dass er wieder anfing zu essen, war für mich der schönste Moment. Während er gegessen hat, habe ich alles aufgeschrieben, was ich an ihm beobachtet habe, jeden kleinen Lichtblick. Damit ich mit den Ärzten reden konnte. Er konnte ja selbst nicht mehr sagen, wie es ihm geht.
Meine Strategie, mit dieser Ausnahmesituation umzugehen, war es, mich in ein künstliches Hoch zu katapultieren. Ich habe in der ganzen Wohnung positive Affirmationen an die Wände geklebt.
- »Wir schaffen das!«
- »Thomas wird wieder zu 100 % gesund!« »Wir machen unsere Weltreise trotzdem!«
Ich habe diese Sätze nicht nur aufgeschrieben, sondern mir auch den ganzen Tag lang vorgesagt. Positiver Brainwash! Bei meinen Besuchen im Krankenhaus habe fast immer nur ich geredet. Tausendmal hab’ ich gesagt »Thomas, ich bin mir sicher, das wird wieder«. Mantraartig wiederholt. Geschichten, wie »Ich habe heute jemanden aus unserem Viertel kennengelernt, der auch zwei schwere Episoden hatte. So wie du und er hat es auch wieder geschafft. Das ist der Papa vom kleinen Max, den kennst du doch!« Ich bin mir nicht sicher, ob meine positive Stimmung Thomas oder mir mehr geholfen hat. Aber die selbst eingeredete Überzeugung, dass alles doch wieder gut werden würde, war das Einzige, woran ich mich klammern konnte.
Es hat lange gedauert, bis Thomas in einer Verfassung war, dass wir gemeinsam spazieren gehen konnten. Mein Leben in diesen Wochen bestand nur darin, zu schlafen, Nik in die Kita zu bringen, Thomas im Krankenhaus zu besuchen, ins Fitnessstudio zur Yogastunde zu gehen, Thomas nochmals zu besuchen und Nik wieder aus der Kita abzuholen. Meine Freunde dachten wahrscheinlich, ich bin vom Erdboden verschluckt worden. »Too busy with my Startup«, habe ich ihnen gesagt. Jedes Wochenende habe ich Thomas dann mit Nik im Krankenhaus besucht. Einmal wurde es mir dort aber unheimlich. Ein verwirrter Patient mit langen Haaren und dicken Kopfhörern hielt in der rechten Hand einen mächtig langen Holzstab. Schön verziert war er. Er lief von Baum zu Baum und schrie ihnen inbrünstig wilde Beschwörungen und Zaubersprüche entgegen. Als er dann anfing, wahllos auf am Boden stehende Kaffeetassen einzudreschen, wurde es mir zu brenzlig. Ich habe Thomas geküsst und mit Nik die Flucht ergriffen. Gegen einen Zauberspruch hatte ich nichts, aber dass Nik jetzt auch noch eine Tasse auf den Schädel fliegen könnte, nein, darauf konnte ich verzichten.
Später, als Thomas Ausgang hatte, wurde dann der kleine Spielplatz an der Theresienwiese unser Ort für Family Time am Wochenende. Anfangs haben wir uns nur eine Stunde gesehen, mehr hat Thomas nicht geschafft. Aber ich sah das Funkeln in seinen Augen, als er seinen Nik sah und dieser freudig »Papa, Papa, Papa, Papa« rief. Von da an wusste ich, dass es langsam bergauf ging. Thomas war ein Kämpfer, auf das konnte ich mich verlassen.
Was folgte, war ein Weg mit vielen Fortschritten und fast genauso vielen Rückschritten. Was ich gelernt habe, ist, dass die Depression, so langsam sie sich in unser Leben geschlichen hat, auch wieder davonschleicht. Ich musste lernen, dass es keinen Quick-Fix gibt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ihm dieses Mal keinen Druck mache. Plan A dauert eben so lange, wie Plan A dauert. Auch wenn es noch ein, zwei oder drei Jahre sein würden!
Monate später habe ich dann erstmals Situationen beobachtet, in denen ich wusste, dass mein alter Thomas zurückkommt. Plötzlich hat er sich die Steuererklärung geschnappt und erledigt. Ich merkte, dass er sich nicht mehr so gut konzentrieren konnte, aber trotzdem hat er es gemacht und durchgezogen.
Auch seine Angstthemen ist er angegangen. Er fing an, sich wieder um unsere Wohnung mit dem Wasserschaden zu kümmern. Als wir mit dem Gutachter, den Rechtsanwälten und Bauarbeitern in der Wohnung standen und er alle zurechtgewiesen hat, war ich stolz! Der alte, neue Thomas war wieder da. Der Thomas in der Depression konnte nicht mal E-Mails lesen, in denen es um diese Wohnung ging. Die Angst hatte ihn gefangen.
Langsam merkte ich, wie er wieder fröhlicher wurde. Ich werde nicht vergessen, wie wir uns totgelacht haben, als er aus einem Witzebuch für Kinder vorgelesen hat:
»Warum ist der Eisbär weiß?«
»Wäre er rot, würde er Himbär heißen!«
Wir haben uns totgelacht. Er und Nik über den Himbeer-Eisbären und ich habe mich so gefreut, dass er wieder lachen konnte!
Als sich Thomas wohler fühlte und am Ende seines stationären Aufenthalts in der Psychiatrie stand, dachte ich, wir hätten die schlimmste Zeit hinter uns. Endlich ein wenig Zeit zum Atmen. Zu früh gefreut! Als der Druck von mir abgefallen ist, ging es dann auch bei mir los mit Schlafproblemen. Fünf, sechs Wochen lang konnte ich nicht erholsam schlafen, bin dauernd aufgewacht. Wir Chinesen sind Weltmeister im Powernapping. Aber davon war keine Spur mehr. Ich habe zuerst Arzneien ausprobiert, die in der Apotheke erhältlich sind, bevor ich mich für ein Schlaflabor angemeldet habe. Mein Hausarzt hat mir ein Schlafmittel verschrieben. Auch mit diesem konnte ich nicht mehr schlafen. Thomas hat sich große Sorgen um mich gemacht. Ging bei mir jetzt auch so etwas wie eine Depression los?
Bei mir stand ein Weinseminar im schönen Rheinland im Kalender. Jetzt mit der Insomnie wollte ich gar nicht hinfahren. Ich wollte stornieren. Jetzt waren es aber Thomas und meine Freundin, die mich gedrängt haben, es trotzdem zu machen. »Du benötigst jetzt Zeit für dich selbst, du hast alles gegeben in den vergangenen Monaten.« Also bin ich trotzdem hingefahren. Zu einem Event mit anderen Wein-Enthusiasten.
Einmal nicht über Depression sprechen, herrlich! Die erste Nacht habe ich wieder nur gedöst. Aber ab dem zweiten Tag, wie durch ein Wunder, habe ich wieder tief und fest geschlafen. So wie immer. Das war mein finaler Turnaround. Nach drei Tagen habe ich die Schlaftabletten entsorgt und mir stattdessen ein gutes Glas Rotwein zum Einschlafen gegönnt.
Die Krankheit von Thomas hat auch mich sehr verändert. Alle, die mich bis dahin kannten, kannten mich nur als »happy«. Thomas und ich hatten bis dahin nie wirkliche Probleme, es lief einfach. Ich war, wie er, sehr zielorientiert und ehrgeizig – Ziele waren mir immer wichtig. Zu versagen kannte ich ebenso wenig wie Thomas. Und plötzlich, als die Depression in unser Leben kam, war ich alles andere als »happy«. Ich war zutiefst unglücklich und fühlte mich als Opfer der Krankheit.
Dieses Erlebnis hat alle meine fundamentalen Lebensannahmen auf die Probe gestellt.
Yoga hat allmählich vieles in mir verändert. Dort gab es keine Sorgen. Dort konnte ich einfach sein und dort durfte ich so viel erleben, was mich rückblickend nachhaltig verändert hat. Ich hatte dort kein Ziel und doch hat es mich seelisch und körperlich geheilt. Ich hatte nicht das Ziel, etwas zu erreichen, aber durch das ständige Üben wurde ich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch stark. Ich habe die heilsame Verbindung zu meinem Atem für mich entdeckt: »Nicht denken, nur atmen«. Mit jedem Ausatmen konnte ich mir innerlich sagen: »Lass es los«.
Mithilfe meiner Life-Coachin, die auch eine meiner besten Freundinnen ist, habe ich erkannt, dass ich mich in jedem noch so herausfordernden Moment dafür entscheiden kann, glücklich zu sein.
Ich weiß nicht, wohin unser Leben gehen wird, aber das stört mich nicht mehr. Heute blicke ich sehr entspannt in die Zukunft, in die Ungewissheit und weiß, dass es immer auch besser werden kann. Dieses Nichtwissen, das ich früher nicht ertragen hätte, entspannt mich und eröffnet mir neue Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten.
Ach ja, während ich diese Zeilen schreibe, hat mir mein Arbeitgeber mitgeteilt, dass ich entlassen worden bin – wenn das keine Chance für einen Neuanfang in meinem Leben ist!
Ende der Leseprobe
»Nach Grau kommt Himmelblau« ein Mut-Macher Buch, das zeigt: Depression ist besiegbar!